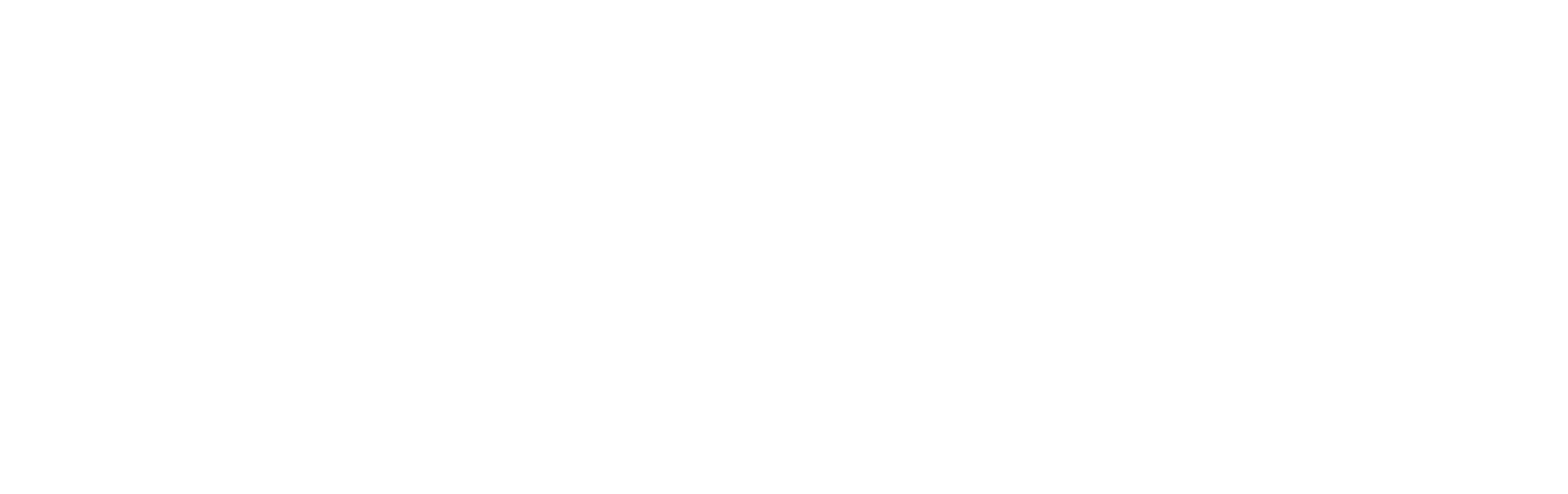Sprachwandel: Ab wann dürfen neue Sprachformen in Übersetzungen verwendet werden?
Else Gellinek
- April 18, 2017
- 8 min read
- Mit Übersetzer*innen arbeiten
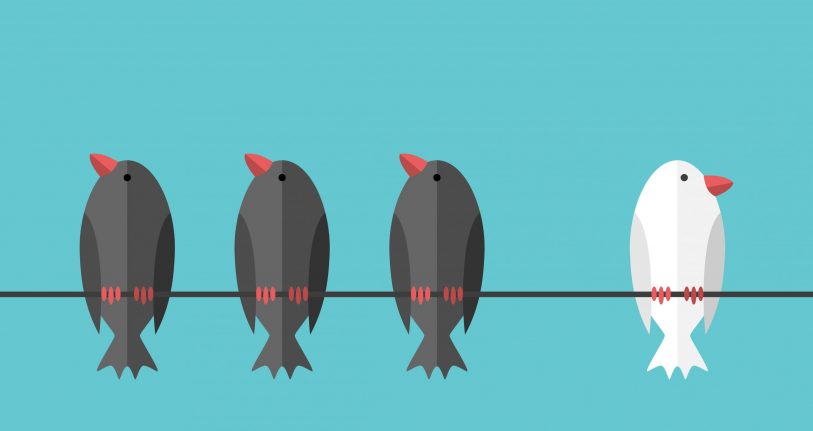
Ein neues Pronomen hält in amerikanischen Medien Einzug
In Sprachen tut sich stets etwas! Ein aktueller Fall ist das englische Pronomen „they“. Für alle, die mit weniger Interesse als ich sprachliche Diskussionen in der Presse verfolgen: „they“ wird im Englischen zunehmend neben der gewohnten Funktion als Personalpronomen der 3. Person Plural auch als Pronomen der 3. Person Singular benutzt. So vermeiden Sprecher, sich auf das Gender der Bezugsperson festlegen zu müssen. Anstatt „The customer entered the store. He was looking for new pants.“ sagt man „The customer entered the store. They were looking for new pants.“ Ob der Kunde männlich oder weiblich ist, wird nicht erwähnt.
Gegner dieser Verwendungsweise wenden ein, dass „they“ nur für mehrere Personen verwendet werden darf und dass alternative sprachliche Formen existieren, die eine neuartige Verwendung von „they“ überflüssig machen. Befürworter setzen dem entgegen, dass es für diese Verwendung zahlreiche historische Sprachbelege gibt und sie also gar nicht so neu ist, wie gerne behauptet wird.
Am Ende des letzten Monats schlug in den Kreisen der Sprachprofis die Meldung große Wellen, dass die renommierte Associate Press nun zumindest in bestimmten Fällen diese umstrittene sprachliche Form zulassen würde. Die Associate Press gibt stilistische Vorgaben für den amerikanischen Journalismus und gilt als nicht allzu versuchsfreudig. Dass diese Institution eine sprachliche Form anerkennt, kann mit einer Aufnahme in den Duden verglichen werden. Eine neue oder nichtstandardsprachliche Form ist somit dem standardmäßigen Sprachgebrauch einen bedeutenden Schritt näher gekommen.
Wieso sollten Übersetzer nichtstandardsprachliche Formen überhaupt beachten?
Man könnte zuerst vermuten, dass Übersetzer sich strikt an althergebrachte und etablierte Sprachformen halten und alles andere mit Missachtung strafen. Die Schriftsprache, mit der Übersetzer schließlich arbeiten, ist seit jeher konservativer als die gesprochene Sprache, die sich schneller wandelt und offener für neue Einflüsse ist.
So einfach ist die Sache nicht – alles andere wäre ja auch langweilig! Es gibt – ganz besonders im Englischen – keine uniforme, einzig richtige Schriftsprache. English ist ein Sammelwort für viele regionale Varianten, die ihrerseits viele Textsorten und Register abdecken. Pauschal neuere Sprachformen abzulehnen kann in eine stocksteife Sprache münden, die dem anvisierten Leser schon fremd geworden ist. Für Sie ist es wichtig zu wissen, dass Texte, die der sprachlichen Realität Ihrer Zielgruppe nicht Rechnung tragen, bei ihr auch keine Wirkung erzeugen können.
In Ihrem Interesse sollten Übersetzer demnach sprachliche Diskussionen und Kontroversen mitverfolgen und abwägen, ob wirklich alle noch nicht offiziell abgesegneten Formen reflexartig abgelehnt werden sollten.
Die folgenden Punkte beachte ich beispielsweise, wenn ich vor solchen Entscheidungen stehe.
Was bei der Verwendung von nichtstandardsprachlichen Formen bedacht werden muss
Wer entscheidet überhaupt, welche Sprachformen zulässig sind?
Die Frage ist weniger rhetorisch als man meinen möchte. Sprache ist ein System, welches in Übereinkunft mit den Sprechern dieser Sprache existiert. Niemand hat die Entscheidungshoheit, auch wenn es für bestimmte Sprache Insitutionen gibt, die dies für sich beanspruchen.
Hier tut sich der Graben zwischen den Lagern der Präskriptivisten und der Deskriptivisten auf. Präskriptivisten wollen sprachliche Regeln ausmachen, die dann allgemeine Gültigkeit haben. Abweichungen gelten dementsprechend als falsch. Das ist eine Haltung, die im Fremdsprachenunterricht durchaus eine Daseinsberechtigung hat. Präskriptivisten hingegen wollen Sprache als System beschreiben, ohne dabei mit Etiketten wie „richtig“ oder „falsch“ zu hantieren. Abweichungen werden als sprachinterne Phänomene begriffen und untersucht. Sprachwandel ist für Deskriptivisten weitaus weniger furchterregend als für Präskriptivisten, die beispielsweise mit dem Schwinden des Genitivs im Deutschen eine Verrohung der deutschen Sprache befürchten.
Die meisten Menschen haben zum Sprachwandel zwei Seelen in ihrer Brust: die eine kann erkennen, dass Sprache sich ändert. Schließlich entstammt das moderne Deutsch einer älteren Sprachform. Die andere Seele trauert um sprachliche Konstruktionen, die dem eigenen Sprachgefühl wertvoll erscheinen, seien es die Genitivformen oder unregelmäßige Vergangenheitsformen wie „buk“ oder „frug“, die langsam den regelmäßigen Formen weichen müssen.
Sprache ist deshalb ein so explosives Thema, weil wir alle ganz spontan eine Meinung dazu haben. Die Klage, dass die Muttersprache durch die nachfolgenden Generationen in den Ruin getrieben wird, ist eine ganz alte und beweist im Wesentlichen, dass Sprachwandel eine stete Begleiterscheinung des Sprechens ist. Regt sich also erbitterter Widerstand gegen sprachliche Entwicklungen, muss man fragen, auf welchen Füßen dieser Widerstand ruht. Auf tönernen vielleicht? Der Widerstand gegen die neue Verwendung von „they“ ist von tiefen Haltungen geprägt, die der Erkenntnis trotzen müssen, dass diese Verwendung eine alte ist, die sogar von literarischen Größen wie Chaucer und Shakespeare benutzt wurde.
Welchen Ursprung hat die neue Form?
Regionale Variante
Wird eine Sprache wie das Englische von so vielen Menschen auf der ganzen Welt gesprochen und zunehmend von Menschen, die Englisch als zweite Sprache erwerben, dann wachsen die möglichen Einflussquellen mit. So ist beispielsweise das Englische, das für EU-Angelegenheiten benutzt wird, eine ganz eigene Sprachvariante mit einer spezifischen Verwendung. Formen des sogenannten Euro-Englisch außerhalb dieses Kontextes zu nutzen bringt keinen Zusatznutzen. In Texten für eine amerikanische Leserschaft haben solche Formen keinen Platz. Schließlich sind sie den Lesern fremd – das wäre kontraproduktiv. Gleiches gilt für andere neue Formen in Regionalvarianten. Das indische Englisch weist sprachliche Strukturen auf, die einem muttersprachlichen Briten als falsche Grammatik aufstoßen würden, da sie von den gewohnten Formen im britischen Englischen abweichen. Nichtstandardsprachliche Formen außerhalb ihrer angestammten Regionalvariante zu benutzen ist riskant.
Die ganz pragmatische Frage ist, ob die Leserschaft die neuere Form überhaupt kennt und eventuell sogar bevorzugt – nicht ob die neue Form richtig oder falsch ist oder ob sie als Bereicherung der Sprache oder als elegantere Lösung empfunden wird.
Bestimmte Branche oder soziale Gruppe
Neue Wörter finden generell schneller Aufnahme als neue Sprachstrukturen. Wir wehren uns weniger gegen neue Vokabeln als gegen Veränderungen in der Grammatik. Manche Branchen, die sich insbesondere mit neuen Technologien beschäftigen, erweisen sich als fruchtbare Quellen für neue Wörter. Das überrascht nicht sonderlich: Um neue Phänomene zu beschreiben, werden Wortneuschöpfungen dem existierenden Vokalbestand an die Seite gestellt.
Manche soziale Gruppe kann auch besonders dazu beitragen, dass sich Sprache immer wieder neu erfindet. Die Jugendsprache als Ausdrucksform der neuen Generationen fließt spätestens mit dem Erwachsenwerden ihrer Sprecher in die Alltagssprache ein. Auch Gruppierungen, die sich als neuere Bewegung in der Öffentlichkeit zeigen, bringen ihren Wortschatz in die Alltagserfahrung mit ein. Vielschichtige Identitäten wollen differenziert kommuniziert werden und ihr Wortreichtum verlässt die Nische für eine breitere Bühne. Wer hätte vor 20 Jahren so viele unterschiedliche Bezeichnungen für ernährungsbasierte Lebenshaltungen gekannt: Fruitarier, Veganer, Paleo, Flexitarier, Pescaterier, Rohkostler?
Welchem Zweck dient die neue Form?
Neben der vielfältigen Herkunft neuen Sprachmaterials müssen Übersetzer bedenken, welchen Zweck neue Wörter oder Formen haben. Beschreiben sie neue Lebensrealitäten oder Errungenschaften und schließen dabei eine lexikalische Lücke? Oder steht hier eine aufklärende oder inklusive Funktion im Vordergrund?
Die genderinklusiven Formen im Deutschen sind ein Beispiel dafür, wie neue Sprachverwendungen neues Bewusstsein schaffen möchten. Hier steht die explizite Erwähnung von Frauen dem sprachlich überlieferten generischen Maskulinum gegenüber. Ob man nun „Studenten“, „Studenten und Studentinnen“ oder die neutralere Formulierung „Studierende“ sprachlich ansprechender findet, ist nur ein Aspekt. Die Wahl der Form drückt auch eine ideologische Haltung aus oder zumindest ein Verneigen vor dieser Haltung. Das singulare „they“ im Englischen beinhaltet neben der sprachlich vereinfachenden Funktion auch eine Meinungskomponente. Diese Ebenen werden häufig bei der Diskussion vermischt, aber es kann sich lohnen, sie separat zu betrachten.
Wer ist die Leserschaft?
Jede Übersetzung muss sich daran messen lassen, wie gut sie die Zielgruppe anspricht. Je konservativer die Textsorte oder das Publikum desto konservativer die Sprache – das ist ein brauchbarer Grundsatz.
Hinzu kommt die Gefahr, dass manche neuen Wörter recht schnell von der Trendwelle abgeworfen werden und zu sogenannten Buzzwords verkommen. Übersetzer müssen auch klar im Blick haben, auf welche Leserschaften welche Wörter irritierend wirken könnten. Auch hier lohnt es sich, sprachliche Diskussionen im Auge zu behalten und mitzubekommen, welche neuen Wörter schon wieder aus der Mode gekommen und auf dem Abstellgleis gelandet sind.
Kurzum: Auf den Kontext kommt es an
Im Alltag sprechen wir und wählen unsere Wörter, meistens ohne unsere Formulierungen auf die Goldwaage zu legen oder bewusst zwischen Alternativen zu entscheiden. Im geschriebenen Wort haben wir mehr Zeit und auch die Pflicht, unsere Wörter mit mehr Bedacht zu wählen. Schließlich haben geschriebene Texte länger Bestand als die gesprochene Sprache.
Die Wortwahl oder Stilebene, die wir für einen Text wählen, wird durch viele Motivationen entschieden. Rein sprachliche Aspekte sind hier ein Teil des Bildes. Bleiben Sie bei juristischen Abhandlungen oder behördlichen Mitteilungen ruhig bei althergebrachten sprachlichen Gewohnheiten. Bewegen Sie sich im Universum der neuen Textsorten in den neuen Medien, kann der Blick über den Tellerrand auf neue Entwicklungen in Sprache und Text der entscheidende Schritt sein, dass Sie von Ihrem Publikum erhört werden.